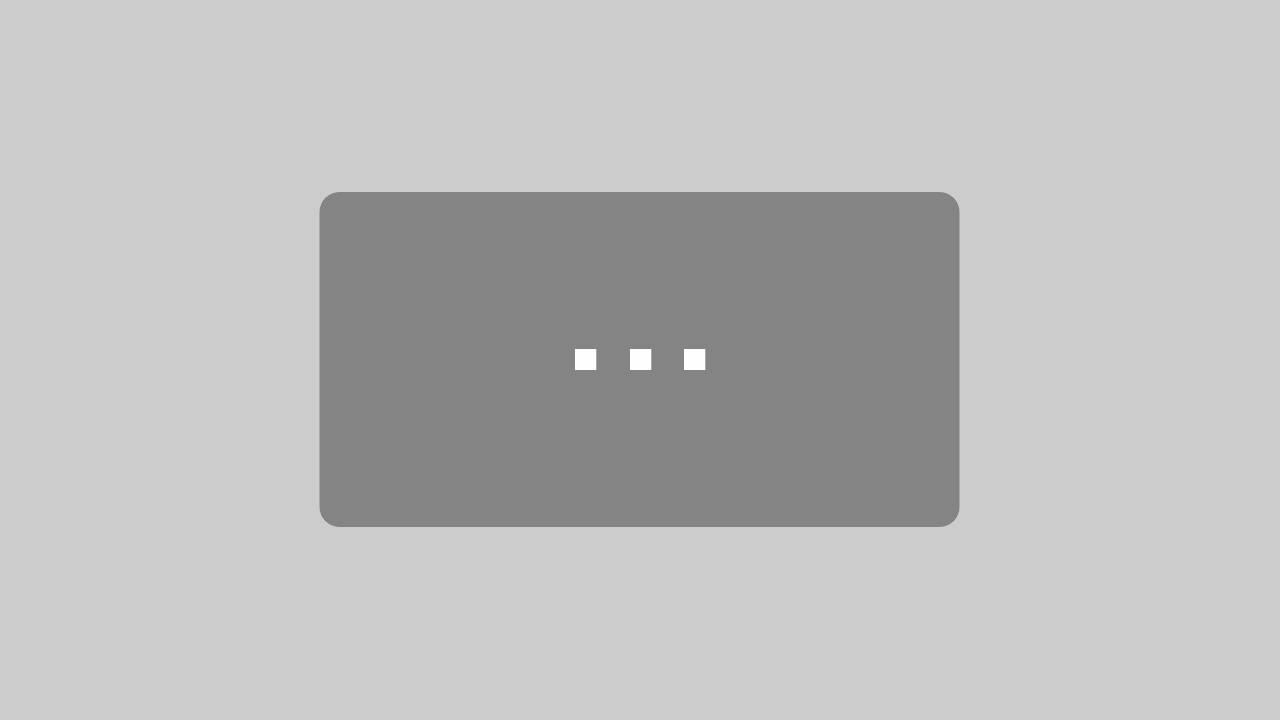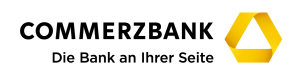„Die amerikanischen Wirtschaftsdaten enttäuschen, das produzierende Gewerbe befindet sich bereits in einer Rezession, das Vertrauen des Marktes in weitere Zinserhöhungen durch die amerikanische Zentralbank ist fast erloschen und der Aktienmarkt kämpft darum, nach dem schlechtesten Jahresstart seit Jahrzehnten wieder Stabilität zu erlangen. Gleichzeitig wird die US-Notenbank beschuldigt, dass sie die Zinszügel zu früh angezogen hat. Kurz gesagt: Die Sorgen nehmen zu und das „R-Wort“ steht wieder auf der Tagesordnung. Rutschen die USA in eine neue Rezession? Unsere Antwort lautet: „Nein, auf keinen Fall!“
Warum kommt es überhaupt zu dieser Diskussion?
Wir können gut verstehen, dass sich manche Menschen aus bestimmten Gründen Sorgen machen. Die Industrieproduktion geht zurück und das Geschäft des produzierenden Gewerbes liegt auf einem niedrigen Niveau. Es sieht sich einem gesamtwirtschaftlichen Umfeld gegenüber, das sich in der Vergangenheit des Öfteren in einer Rezession befand. Dazu kommen eine deutliche Straffung der allgemeinen Finanzierungsbedingungen – wie höhere Finanzierungskosten für Anleiheemittenten oder niedrigere Aktienkurse – und vor allem ein wesentlich stärkerer US-Dollar. Letztendlich entsteht Unruhe in den Schwellenländern, was sowohl zu einem niedrigeren Exportwachstum als auch zu einem erhöhten Volatilitätsrisiko an den Finanzmärkten führt. Die Liste ist lang und eine gewisse Besorgnis durchaus gerechtfertigt.
So weit, so gut, aber die Panik ist nach wie vor übertrieben
Nichtsdestotrotz haben sich diese Sorgen unseres Erachtens jetzt in panikartige Zustände verwandelt. Und das führt – trotz der Herausforderungen – zu einer übertriebenen Nervosität. In Anbetracht der aktuellen Situation kommen wir zu dem Schluss, dass es sich um eine Reihe mittelfristig negativer Störfaktoren für die amerikanische Wirtschaft handelt.
Störfaktor Nummer Eins ist die Stärke des US-Dollars: Dieser verzeichnete einen Anstieg von über 20 Prozent auf handelsgewichteter Basis seit seinem Tiefpunkt im Jahr 2014. Das beeinflusst sowohl das Exportvolumen als auch die Gewinne auf US-Dollar-Basis. Aber der Dollar kann naturgemäß nicht bis in alle Ewigkeit aufwerten und irgendwann wird das Tempo der Aufwertung nachlassen. Obwohl wir weiterhin der Meinung sind, dass niedrigere Ölpreise der amerikanischen Wirtschaft generell zugutekommen, sind sie eine große Belastung für gewisse Teilbereiche. Auch wenn wir dem Ölpreis keineswegs optimistisch gegenüberstehen, kann er zudem nicht immer weiter fallen.
Auch unsere Einschätzungen für China und die Schwellenländer sind wenig optimistisch: Das Wachstum in China hat sich – angeführt von einem rückläufigen Bausektor – bereits halbiert. Sowohl Brasilien als auch Russland befinden sich schon in einer tiefen Rezession. Das wird sich auch in der nächsten Zeit nicht so schnell ändern und China wird kurzfristig nicht zu seinen früheren hohen Wachstumsraten zurückkehren. Es gibt aber z.B. trotzdem Grenzen für den Wachstumsrückgang in Brasilien, wo das Wachstum letztes Jahr um katastrophale 7,5 Prozent zurückging.
Die negativen Auswirkungen auf die USA sind deshalb nur mittelfristig zu spüren und von externer Natur. Sie treffen diejenigen Bereiche der amerikanischen Wirtschaft, die am stärksten vom Rest der Welt abhängig sind – und das ist das produzierende Gewerbe.
Daten für den Industriesektor verzerren das Bild
Die Finanzmärkte hungern stets nach Informationen: Wo steht die Wirtschaft gerade? In welche Richtung geht es? Statistiken geben jedoch leider immer nur partielle und vergangenheitsbezogene Einblicke. Im Laufe eines durchschnittlichen Monats gibt es z.B. mehr Daten für den amerikanischen Industriesektor als für den Dienstleistungssektor. Das ist teilweise dem jahrzehntelangen Status der USA als Industriewirtschaft geschuldet, aber auch der Tatsache, dass es viel leichter ist, einen Automobilhersteller zu fragen, wie viele Autos er produziert hat, als einen Arzt zu fragen, welchen Wert ein Krankenhaus oder eine Arztpraxis im Laufe eines Monats generiert hat.
Am laufenden Datenstrom hat das produzierende Gewerbe also mehr Anteil als an der tatsächlichen Wirtschaftsleistung. Die Wertschöpfung in der Industrie als Anteil an der Gesamtwirtschaftsleistung ist z.B. über die letzten Jahrzehnte auf aktuell unter 15 Prozent gefallen. Lediglich 10 Prozent der Arbeitskräfte sind heute im produzierenden Gewerbe beschäftigt. Trotzdem kommen 40 Prozent des monatlichen Datenstroms aus der Industrie. Dies sollte man sich vor Augen halten, denn die externen Störfaktoren belasten den Industriesektor, während sich die Dienstleistungsbranche bis jetzt überraschend gut entwickelt und unter anderem viele neue Arbeitsplätze geschaffen hat.
Ganz wesentlich ist jedoch, dass das Wachstum in der Gesamtwirtschaft aus Quellen kommt, die man nur sehr schwer erfassen kann. So haben Studien aus dem Jahr 2010 ergeben, dass neue kleine Unternehmen in einem durchschnittlichen Jahr der treibende Faktor hinter der Schaffung neuer Arbeitsplätze waren. Ohne sie würde die Beschäftigung stagnieren. Kleine neue Unternehmen sind von Natur aus schwer zu erfassen, teils, weil sie nicht sehr präsent sind, teils, weil sie in der Vergangenheit noch nicht existierten.
Wenn die Frage einer Rezession im Raum steht, konzentrieren wir uns deshalb vor allem auf das Bankensystem und den Immobilienmarkt. Ohne ein gut funktionierendes Bankensystem können Unternehmer und Innovatoren keine neuen Firmen gründen und expandieren. Der Immobilienmarkt ist für viele Unternehmer die primäre Finanzierungsquelle. Steigende Immobilienpreise und der Zugang zu Immobilienkrediten sind daher die wesentlichen Bedingungen für Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Es ist keine Bankenkrise in Sicht – und deshalb auch keine Rezession
Unser größtes Augenmerk legen wir auf die Überprüfung, inwieweit sich das Bankensystem in einer Krise befindet. Momentan gehen wir davon aus, dass Banken bei der Kreditvergabe an den Energiesektor und damit verbundenen Branchen Verluste erleiden. Die Zeit nach der Krise 2008/2009 wurde genau dem gewidmet: Dem Aufbau eines besseren und stabileren Bankensystems, das nicht mehr so leicht zusammenbricht wie zuvor. Ein höherer Kapitalbedarf, eine bessere Liquidität und mehr Transparenz bedeuten für uns, dass das Bankensystem mit dem bevorstehenden Verlust fertig werden kann, ohne die Kreditvergabe an anderen Stellen zu stark zu kürzen. Das wurde diese Woche von der jüngsten Umfrage zur Kreditbereitschaft der Banken, dem Senior Loan Officer Survey, bestätigt.
Die Umfrage zeigt, dass einige Banken die Bedingungen für Unternehmen straffen, aber das sind nur wenige Institute. Das Wichtigste ist, dass die Banken die Bedingungen für Verbraucher im Allgemeinen und Immobilienkredite im Besonderen weiter lockern. Dabei kommt den Immobilienkrediten eine besondere Bedeutung zu, denn das größte Hindernis für eine Normalisierung der Wohnungsbauaktivitäten sind zu strenge Kreditkonditionen. Wir gehen somit davon aus, dass der Wohnungsbau in den kommenden drei Jahren um 20 bis 40 Prozent zunehmen wird und so die Wirtschaft in einer Zeit stützt, in der es der Industriesektor schwer hat.
Deshalb ist das Gerede darüber, dass die amerikanische Notenbank (Fed) einen Fehler gemacht hat, unseres Erachtens fehl am Platz. Anders ausgedrückt: Wenn die Fed den Normalisierungsprozess nicht eingeläutet hätte, würden die Finanzmärkte und Banken vielleicht immer noch wahllos Kapital und Finanzierungen zur Verfügung stellen, z.B. dem Energiesektor. Selbst Notenbankchefin Janet Yellen hat im Sommer 2014 darauf hingewiesen, dass zu viele Kredite an Unternehmen mit geringer Bonität ausgegeben wurden.
In sechs Monaten geht es wieder bergauf
Stellen Sie sich vor, wie stark die Wirtschaft wäre, wenn der Dollar nicht als direkte Folge der frühen Normalisierung der Geldpolitik an Wert gewonnen hätte. Dann wäre die Arbeitslosigkeit in den USA noch niedriger und die Lohninflation wesentlich höher. So hätte sich die Fed genötigt gesehen, die Zinszügel schnell anzuziehen. Das wäre in Wirklichkeit ein schwieriger Prozess gewesen.
Stattdessen versucht die Fed durch turbulente Zeiten zu navigieren und strebt Finanzierungsbedingungen an, die Wachstum schaffen und damit die Inflation hervorbringt. Letztere erlaubt es der Fed, ihr Ziel von Vollbeschäftigung und zwei Prozent Inflation zu erreichen. Jetzt haben die Märkte die Zinserhöhung der Fed gemeistert, weshalb sie sich Zeit lassen kann. Gerade weil die Fed rechtzeitig begonnen hat, kann sie nun schrittweise vorgehen und so die Zinserhöhungen der aktuellen Entwicklung an den Finanzmärkten anpassen.
Aktuell herrscht an den Märkten Panik. Diese Panik ist unserer Meinung nach übertrieben, aber auch teilweise verständlich. In sechs Monaten gibt es mehr Klarheit über die negativen Folgen insbesondere der niedrigen Ölpreise. Aber auch dann wird das Bankensystem immer noch funktionieren und der Immobilienmarkt sich weiter erholen. Damit ist Panik vor einer Rezession hinfällig – und die Fed kann ihre gemächlichen Zinserhöhungen fortsetzen. Darauf freuen wir uns.“