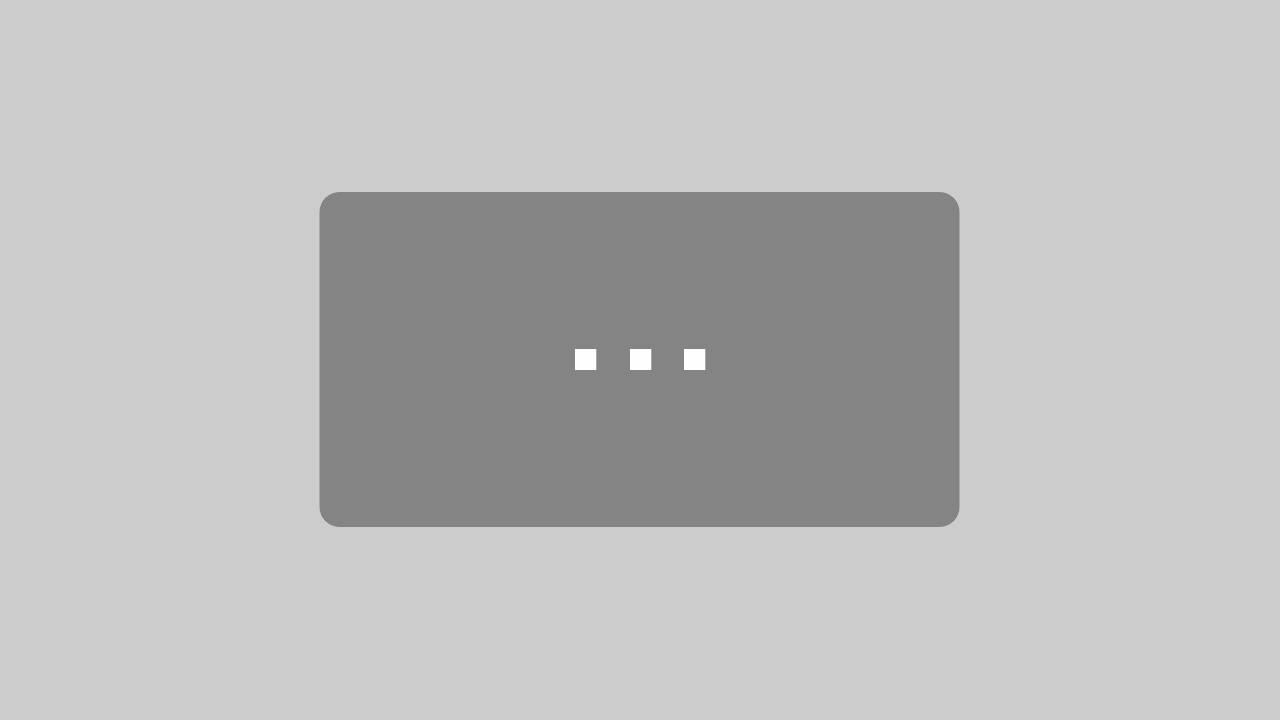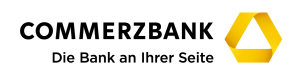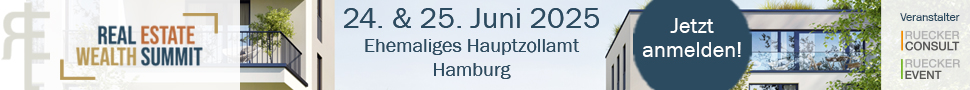Wenn die Fed in dieser Woche den Beginn des Taperings verkündet, sinken die monatlichen Wertpapierkäufe von derzeit 120 Milliarden US-Dollar zunächst wahrscheinlich um 15 Milliarden Dollar. Bis zum Sommer des kommenden Jahres könnten sie ganz auf Null zurückgefahren werden. Bis dahin wächst die Bilanzsumme der Notenbank allerdings weiter und erreicht ein Volumen von mehr als 9 Billionen Dollar – rund zehnmal so viel wie im Jahr 2008 und mehr als doppelt so hoch wie vor der Corona-Pandemie. Die Zahlen zeigen, dass diese ersten Schritte zur geldpolitischen Straffung nichts an der grundsätzlich expansiven Ausrichtung der Geldpolitik ändern.
Fed ist auch dem Ziel der Vollbeschäftigung verpflichtet
Im Laufe des kommenden Jahres dürfte die Fed den Leitzins, den sie im März 2020 drastisch von 1,75 Prozent auf 0,25 Prozent gesenkt hatte, erstmals wieder anheben. Die momentane Erwartung der Märkte, dass es gleich zu zwei Zinsanhebungen kommt, ist zwar im Lichte anhaltend hoher und weiter steigender Inflationsraten nachvollziehbar. Auch Fed-Vertreter haben zuletzt Zweifel geäußert, dass die höhere Inflation tatsächlich nur vorübergehenden Charakter hat, so wie es bislang kommuniziert wurde. Mit einer zweifachen Zinsanhebung im Jahr 2022 ist jedoch nicht unbedingt zu rechnen. Die Fed macht die Entscheidung über die Leitzinsen nämlich nicht nur von der Inflationsentwicklung abhängig, sondern auch davon, dass wieder Vollbeschäftigung erreicht wird. Das impliziert eine Arbeitslosenquote unter 4 Prozent, eine Arbeitsmarktbeteiligung, die ungefähr auf dem Niveau von Anfang 2020 liegt, und ein spürbar anziehendes Lohnwachstum unabhängig von pandemiebedingten Verzerrungen, die derzeit am Arbeitsmarkt noch zu beobachten sind. Es ist zwar gut möglich, dass all diese Voraussetzungen bereits im kommenden Jahr erreicht werden – sehr wahrscheinlich ist es aber nicht.
Hohe Staatsverschuldung spricht gegen eine Zinswende
Dass die Fed auf diese Weise bereits vorsorglich Argumente liefert, die einen eher vorsichtigen Ausstieg aus der ultraexpansiven Geldpolitik nahelegen, liegt nicht nur an ihrem Auftrag, der anders als bei der EZB explizit auch das Ziel der Vollbeschäftigung umfasst, sondern auch an einem ungenannten Faktor: Spätestens mit der Corona-Krise haben die Notenbanken ein neues geldpolitisches Regime etabliert, das auch die mehr oder weniger offene Finanzierung der Staaten nicht ausschließt. Angesichts einer im Zuge der Corona-Krise auf mehr als 130 Prozent des BIP angewachsenen Verschuldung gewinnt dieser Faktor an Gewicht, weil steigende Zinsen sehr schnell die Handlungsfähigkeit der amerikanischen Regierung an Grenzen bringen und das generelle Vertrauen in die Schuldentragfähigkeit des Landes erschüttern könnten. Hinzu kommt, dass die laufende politische Debatte im Kongress keine ernsthaften Maßnahmen zur Begrenzung der Verschuldung erwarten lässt. Im Gegenteil: Weil die Demokraten die Ausgaben weiter steigern wollen, die Republikaner aber gegen jede Form von Steuererhöhungen sind, ist ein weiteres Anwachsen des Schuldenberges das wahrscheinlichste Szenario.
Die Fed wird auf diesen Umstand Rücksicht nehmen (müssen), gerät aber damit in ein Dilemma: Ein langsamer Pfad von Zinsanhebungen könnte zu wenig sein, um die Inflation einzudämmen, und hohe Inflationsraten könnten ihrerseits die Langfristzinsen nach oben treiben, die bislang nicht unmittelbar von der Fed kontrolliert werden. Ein Szenario, in dem die Fed mittelfristig – nach japanischem Vorbild – zu einer Kontrolle der Langfristzinsen übergehen könnte, bleibt also denkbar. Das Ergebnis einer Geldpolitik, die in den zurückliegenden Krisen eine enorme Liquidität geschaffen hat und diese auch im Aufschwung nicht wieder zurückfährt, wäre eine systemisch hohe Inflation, auf die sich Bürger, Unternehmen, Analysten und Marktteilnehmer gleichermaßen einstellen sollten.
(FERI)